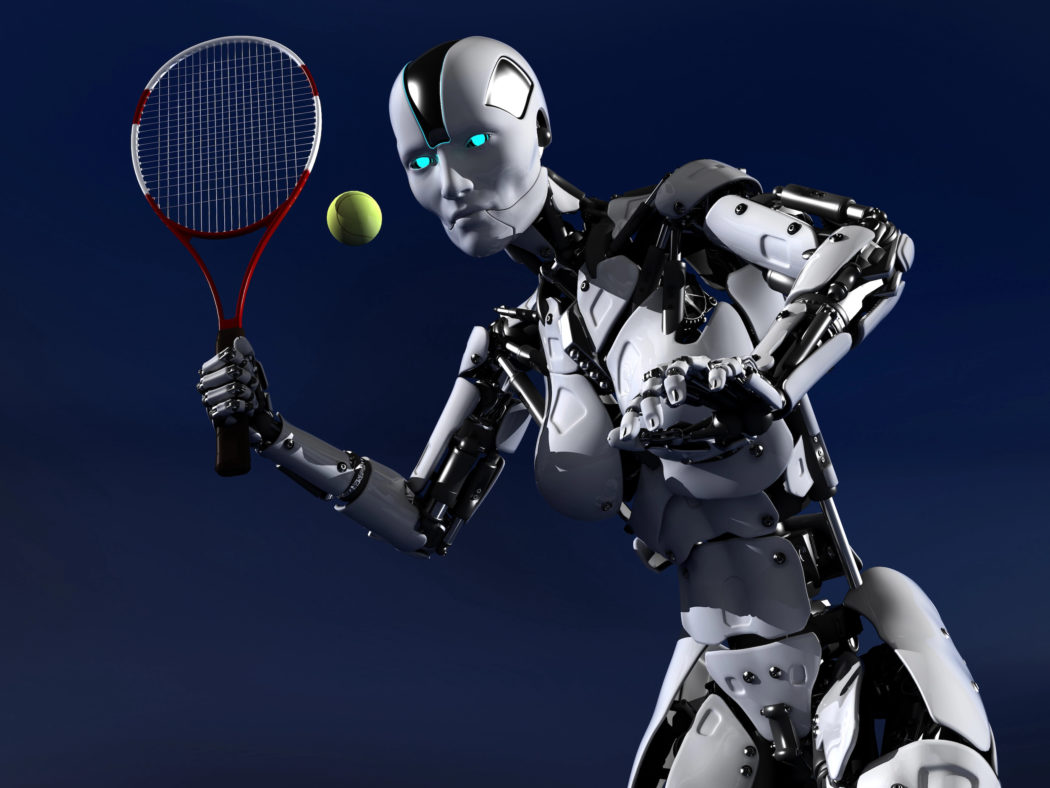„Roboter im Tennistraining – Wir sind auf dem Weg”
Gegenüber steht kein Mensch, Fans nehmen Einfluss auf den Wettkampf – das sind nur einige Aspekte, die unser Experte Prof. Sascha L. Schmidt in der Zukunft sieht. Ein Gespräch über Technologie, Teilhabe und Community statt Vereinsleben.
Interview: Andreas Eckhoff und Martina Goy
Herr Professor Schmidt, Ihr Thema ist die Digitalisierung im Sport. Lassen Sie uns einen Blick aufs Tennis werfen: Wann steht auf der anderen Seite des Netzes als Trainingspartner ein Roboter?
Prof. Sascha L. Schmidt: In den nächsten vier oder fünf Jahren wird es den Roboter als Trainingspartner noch nicht geben. Aber wir sind auf dem Weg dorthin. Schon jetzt gibt es ja eine Art digitalen Vorfahren, der einen kompletten Spielstil simulieren kann. Kommen irgendwann Haptik und Robotik dazu, haben wir einen humanoiden Spielpartner. Spätestens in zehn Jahren wird es soweit sein, dass er gelernt hat, den Ball zurückzuschlagen, also auch mit einem Trainingspartner in Interaktion zu treten.
Wie wird die Digitalisierung den Tennissport denn in näherer Zukunft verändern?
Technologie wird Tennis auf drei Ebenen verändern: Athleten, Wettkampf und Fan-Engagement. Schon jetzt trainieren Athleten zunehmend mit KI-gestützten Tools, und digitale Zwillinge übernehmen Analysefunktionen. Beides wird Tennisspieler noch einmal signifikant verbessern.
Wie schätzen Sie Trainingstools wie die Wingfield-Box oder das klassische Video ein?
Smarte Systeme wie Wingfield oder SwingVision ermöglichen datenbasiertes Coaching und personalisierte Trainingspläne. Sie fangen mit Hilfe von Kameras Daten zum Spielverlauf ein und werten sie aus. Darüber hinaus gibt es die so genannten Wearables, die geometrische Daten wie Herzfrequenz und Erholung in Echtzeit tracken. Das alles ist nicht nur etwas für Profis, sondern zunehmend auch für Amateure und Hobbyspieler.

Sport der Zukunft? Echte Courts plus Videoleinwänden und humanoiden Robotern.
Wie wichtig sind diese Systeme denn wirklich? Viele Amateursportler ernähren sich ja bereits gesund, treiben vernünftig Sport. Werden da nicht Daten gesammelt, die man gar nicht braucht?
Die Nutzung liegt im Ermessen des einzelnen. Interessant sind die Möglichkeiten aber schon, denn KI-Anwendungen finden sich zunehmend auch im Freizeitsport. Die grundsätzliche Frage ist immer: Mag man es, sein Training datenbasiert zu steuern und danach zu leben, oder mag man es nicht.
Wie verändert Daten-Tracking den Profi- aber auch Freizeitsport?
Der Profisport fungiert grundsätzlich als Testlabor für alle Innovationen. Bei den Profis reisen Datenanalysten schon heute mit den Spielern zu Turnieren. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es für alle Profis Standard wird. Und was sich bei den Profis bewährt, findet man später auch im Breitensport wieder. Im Alltag erfassen wir ja auch schon unsere Bewegungsdaten, beispielsweise mit dem stark verbreiteten Schrittzähler auf der Smartwatch oder dem Handy.
Hilft die Digitalisierung des Trainings, mehr Jugendliche für den Sport zu interessieren, weil es auch auf die Welt der Computerspiele einzahlt?
Durchaus. Digitale Tools ermöglichen einen niedrigschwelligen Einstieg. Ein gutes Beispiel ist der Fußball. Viele Kinder und Jugendliche entdecken über das populäre Fußball-Videospiel EA SPORTS FC ihre Begeisterung für den realen Fußball. Das Spiel zählt regelmäßig zu den meistverkauften Videogames weltweit.
Steht realer Sport in Konkurrenz zum digitalen Sport oder befruchten sie sich gegenseitig?
Digitaler und realer Sport gehören heute schon zusammen. Es wäre künstlich, sie zu trennen. Deshalb gibt es beispielsweise auch bei der Frage, wie der Tennisklub der Zukunft aussehen sollte, kein ,Entweder-oder‘ sondern unbedingt ein ,Sowohl als auch‘. Natürlich steht bei einem Tennisklub nach wie vor der reale Sport im Vordergrund. Aber auch die Möglichkeit, dort in entsprechender technischer Infrastruktur das virtuelle Tennisspiel auszuprobieren, ist wichtig. Beides gehört heutzutage untrennbar miteinander verbunden.

Humanoide Roboter, die um ein virtuelles Spielfeld stehen, auf dem jede Bewegung, jeder Schlag durch Daten erfasst und dargestellt wird.
Wie verändert Technologie den Beruf des Trainers?
Die Rolle des Trainers wandelt sich vom Ballzuspieler hin zum Dateninterpreten und Motivator. Es gibt immer mehr Hilfssysteme, die er nutzen kann. Diese ersetzen den Trainer allerdings nicht, sondern entlasten ihn. Als Coach muss ich mich aber mit digitalen Tools vertraut machen und offen sein für neue Technologien. Und ich sollte wissen, womit sich Kinder und Jugendliche beschäftigen, damit ich mit ihnen auf einer Wellenlänge bleibe.
Was bedeutet die zunehmende Technisierung für die Trainerausbildung des DTB und des VDT?
Es wird einiges passieren in der Weiterbildung, in der Datenanalyse, aber auch bei der Integration von Gamification-Elementen ins Training. Neue technische Möglichkeiten werden neue Trainingsformen, aber auch mehr Unterhaltung und mehr Interaktivität ins Training bringen. Das wird nicht heute oder morgen passieren, denn Anpassungsprozesse dauern zumeist mehrere Jahre, obwohl die Technik bereits zur Verfügung steht. Perspektivisch gilt es aber, das Training mit Hilfe technologischer Innovationen neu zu denken und die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen.
Was genau meinen Sie mit Gamification-Elementen?
Ich denke beispielsweise an Augmented Reality. Mit Hilfe von AR-Datenbrillen lassen sich dem Training gezielt künstliche Elemente hinzufügen. Sobald Datenbrillen so selbstverständlich getragen werden wie normale Brillen, wird AR alltäglicher Bestandteil des Trainings sein.
Wie genau funktioniert das?
Elemente, die man aus Videospielen kennt, werden auf dem Tennisplatz Einzug halten. Wie bei einem Videospiel erhält ein Spieler beispielsweise Bonuspunkte, wenn er bestimmte Felder im Court trifft. Diese Felder werden nicht mehr real etwa mit Hütchen auf dem Platz markiert, sondern der Spieler sieht sie virtuell durch seine Brille.
Wann wird man diese Elemente nutzen können und werden sie überhaupt für jedermann bezahlbar sein?
Technisch ist die Hardware nicht mehr weit entfernt, in China wurden erste Datenbrillen in Sonnenbrillenformat gerade erfolgreich gelauncht. Wann sie allerdings so erschwinglich sein werden, dass sie sich bei uns im Massenmarkt durchsetzen, kann man nicht vorhersagen.
Wenn man Sportarten miteinander vergleicht: Wie weit ist der Fortschritt im Tennis?
Individualisierte Sportarten wie Tennis, Golf oder Motorsport sind grundsätzlich besonders technikaffin. Dort gibt es viele messbare Parameter wie beispielsweise Geschwindigkeit oder Genauigkeit. Tennis ist eine Sportart, wo es relativ einfach ist, neue technische Elemente zu integrieren, ohne den Sport stark zu verändern. Aber ganz ehrlich: Bislang ist Tennis noch nicht als Speerspitze der technologischen Entwicklung in Erscheinung getreten.
Sie nannten drei Ebenen, auf denen die Veränderung stattfindet. Was passiert bei den Wettkämpfen? Und wie gestaltet sich das Fan-Engagement neu?
Wettkämpfe und Fan-Engagement gehen Hand in Hand. Interaktion und Partizipation bestimmen in Zukunft weite Teile des Sports. Neue Formate mit interaktiven Elementen wie Fanabstimmungen per App, Bonuskarten und mehr gibt es bereits. In der Formel E im Motorsport beispielsweise können Fans schon heute über digitale Modelle real Rennen beeinflussen, indem sie ihrem Lieblingsfahrer durch Voting einen Leistungsboost verleihen. Das kann bei Überholmanövern entscheidend sein. So nehmen Fans direkten Einfluss auf die Performance ihres Fahrers.
Man könnte Fans ja auch auf der ATP- und WTA-Tour mit einbeziehen. Der Lieblingsspieler bekommt zum Beispiel einen Aufschlag mehr, also drei…?
Die Beteiligung von Fans ist auf jeden Fall ein Megatrend. Junge Zuschauer wollen ihren Sport nicht mehr nur passiv erleben, sondern aktiv mitbestimmen, wenn möglich sogar Einfluss nehmen.
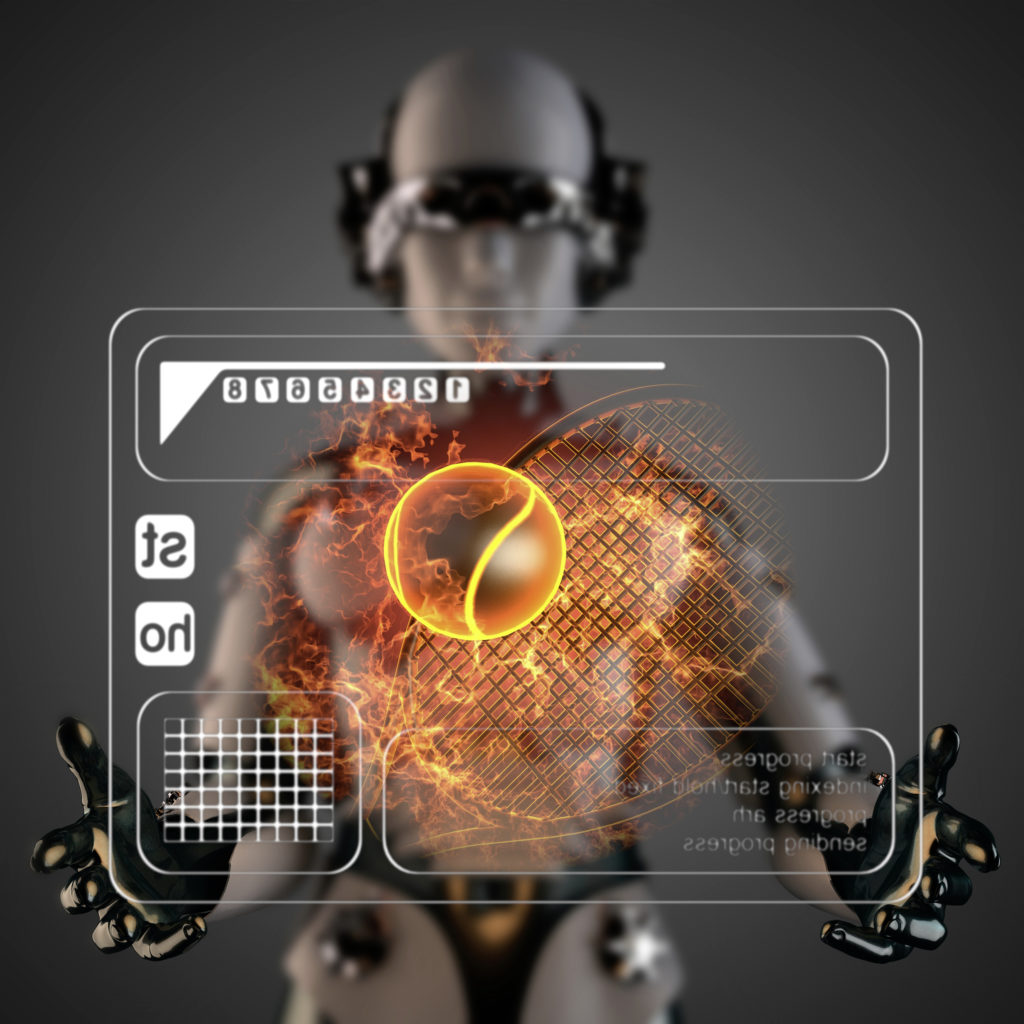
Datenanalyse: In China ist AR in Form von Sonnenbrillen schon gelauncht.Bild: Imago
Führt digitale Partizipation auch zu Interesse am realen Sport?
Um aktiv Tennis zu spielen, muss ich mich überhaupt erst einmal dafür interessieren. Dabei können beispielsweise spezielle Streaming-Formate helfen. Die Formel 1 war in den USA lange Zeit in einer Talsohle, was die Beliebtheit bei Fans anging. Dann kam die Doku ,Drive to Survive‘ und löste einen Boom aus. Mit der Doku ,Break Point‘ versucht auch das Tennis, sich mehr in der Mitte der Gesellschaft zu etablieren. Die Idee dahinter ist gleich: Interesse am Sport wecken. Das eine soll das andere befruchten.
Wie sieht Ihr Fazit für den Tennisklub der Zukunft aus?
Tennis wird hybrider, technischer und unterhaltsamer. Die Community wird immer wichtiger, dort verschmelzen soziale Fäden mit Sport und Entertainment. Leute gehen in ihren Verein nicht nur, um zu spielen, sondern um Teil einer Community zu sein. Dort finden dann auch nicht mehr nur eine, sondern mehrere Sportarten nebeneinander statt. Ich kann mir durchaus Mischformen für Medenspiele vorstellen, wo vielleicht nicht nur Tennis, sondern eine Kombination aus Tennis, Padel und Pickleball gespielt werden. Multifunktionsanlagen ersetzen reine Tennisvereine. Und es gibt Angebote für Kinder und Erwachsene, Singles und Familien.
Früher nannte man das mal Vereinsleben. Tatsächlich ist es aber so, dass die Verweildauer der Tennisspieler in ihren Vereinen zurückgeht. Club und Trainer werden eher als Dienstleister wahrgenommen, die man bucht und bezahlt. Ist es nicht schwierig, nun wieder einen Communityhub aufzubauen?
Das Bedürfnis nach Community, nach einem Miteinander mit anderen Leuten, ist doch da, gerade nach der Corona-Pandemie sehr stark. Was man allerdings tatsächlich sieht, ist eine stärkere Individualisierung, beispielsweise durch die Vorausbuchung von Plätzen. Ich glaube, man muss bei den Kindern anfangen. Die brauchen einen Grund, länger als für die eine gebuchte Stunde im Klub zu bleiben. Das zu ändern, ist mit einer einzelnen Maßnahme nicht hinzukriegen. Aber die Chance dazu ist da, und die Bedürfnisse der Menschen auch.
Funktioniert diese Form von hybridem Tennis schon irgendwo?
Ja. Ich kenne einen Düsseldorfer Verein, der so ein Entertainment-Format etabliert. Freitagabend ist dort Padel-Abend mit einem DJ und Barbetrieb. Das funktioniert großartig. Man muss einfach den Mut haben, neue Wege zu gehen, Dinge auszuprobieren und auch mal ein Scheitern auszuhalten. Einen geraden Erfolgsweg gibt es nie. Dennoch sollten wir uns auf den Weg machen.
Vita
Professor Sascha L. Schmidt ist Inhaber des Lehrstuhls und akademischer Leiter des Centers für Sports und Management an der Otto Beisheim School of Management (WHU) in Düsseldorf. Sein Forschungsschwerpunkt ist die „Zukunft des Sports“. Zuvor war er für die Unternehmensberatung McKinsey tätig. Als Unternehmer baute er das Deutschlandgeschäft des Personaldienstleisters a-connect aus, seit 2011 das Institute for Sports, Business & Society an der EBS Universität auf. 2014 folgte dann sein Wechsel an die WHU. Er ist Dozent am Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sports Entrepreneurship Bootcamp sowie Mitglied der „Digital Initiative“ an der Harvard Business School in Boston.